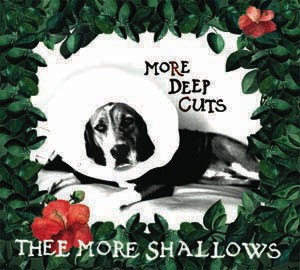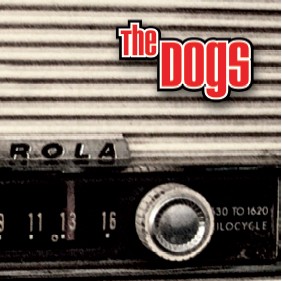Gefühlt ist es kaum einen Wimpernschlag her, dass ich SHAME an einem Samstagmittag auf dem Reeperbahn Festival in der Sky Bar entdeckte. Tatsächlich liegt dieser sagenumwobene Auftritt inzwischen neun Jahre zurück. Damals hatten die Briten gerade einmal eine EP und eine Single veröffentlicht. Offenbar setzte jedoch schon damals jemand alles auf eine Karte und schickte die jungen Flegel kurzerhand aus dem Süden Londons über den Ärmelkanal direkt auf den Kiez. Rückblickend: eine goldrichtige Entscheidung! Heute stehen SHAME bei vier Longplayern, und bereits ihr zweites Album schaffte es sowohl in den UK als auch hierzulande in die Top 10.
Vom rohen Post-Punk der Anfangstage entfernten sie sich schnell – oder besser: Sie erweiterten ihr Klangspektrum beträchtlich. Schon das Debüt ließ Einflüsse aus Noise, Indie, New Wave und Pop erkennen. „Drunk tank pink“ zeigte die Band dann noch vielseitiger: mit Ausflügen in World Music und 80s-Pop, insgesamt aber gereifter, erwachsener. Auf „Food for worms“ kamen schließlich sogar Balladen hinzu – natürlich im SHAME-Kosmos, also mit schief gestimmten Gitarren, rauen Vocals und bewusster Dissonanz.
Dass die Briten diesen Drang zur Weiterentwicklung nun auch auf „Cutthroat“ fortsetzen, überrascht kaum. Warum nicht elektronische Elemente ausprobieren, mit denen Gitarrist Coyle-Smith zunächst nur auf Tour herumspielte? Sie taugen schließlich auch für den Indie-Dancefloor. Dazu wagt die Band Ausflüge in Rockabilly („Quiet life“) und Country („Spartak“). Und dann „Lampião“: ein folklastiger Song mit Elektrodrums, in dem ausgerechnet Charlie Sheen auf Portugiesisch von einem brasilianischen Kriminellen singt, den die einen verehren und die anderen wegsperren wollen. Schließlich klingt das Album mit „Axis of Evil“ aus – einem Song, der auch in einer Achtziger-Disco bestens aufgehoben wäre.
All das fügt sich nicht zu einem Flickenteppich, sondern zu einer Handschrift. SHAME verändern sich, ohne sich zu verlieren. Und während man sich fragt, wo diese stilistische Weitsicht eigentlich herkommt, bleibt ein weiterer Fakt fast absurd: Keiner in dieser Band ist bislang dreißig.