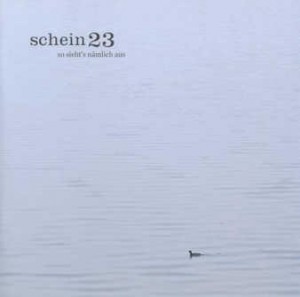Gemächlich spült „Shore“ an die Küste der Hörer:innen. Dezent klopft es an die Tür, öffnet sie vorsichtig und schaut erst einmal ins Zimmer, bevor es sich die ersten Schritte hinein wagt. Mit „Sunblind“ nimmt das Album dann langsam Fahrt auf und segelt durch folkige Meere, mit Rettungsbooten aus Pop. Viel Hall, viel Beiwerk, alles wirkt gekonnt und richtig platziert – aber aus irgendeinem Grund packt es nicht wirklich, plätschert eher nebenher, verlangt auch nicht die volle Konzentration, sondern scheint sich in der Rolle des Begleiters recht wohl zu fühlen.
Eben an einem sicheren Platz, zu dem Robin Pecknold, der Frontmann der FLEET FOXES, „Shore“ erklärt, einen Ort, von dem sich Abenteuer starten lassen, der aber zunächst einmal die Sicherheit bietet, um wieder träumen zu können. Träumen kann man mit „Shore“ gut, das Album dient hier als Katalysator der Gedanken, lässt sie schnell abschweifen. Leider auch weg von der Musik, die mir häufig zu elegisch, zu ausgewalzt ist, zu selten auf schmückendes Beiwerk verzichtet und einfach nur den Song wirken lässt. „Shore“ ist ein Album, das etwas träge wirkt, als würde man an einem Sonntagmorgen aufwachen und denken: „Ach, ich dreh‘ mich nochmals um!“ Ein träumerisches Album, ja, aber keines, das aus dem Schlaf reißt.