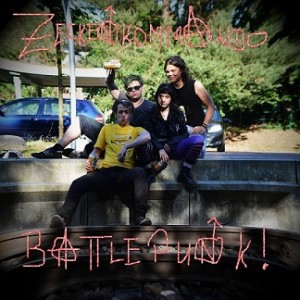Eine Platte, laut Band-Info für Fans u.a. von ALICIA KEYS und MACY GRAY, veröffentlicht auf dem Krawall-Label Ipecac um Chef-Querdenker Mike Patton? Da darf man wohl gespannt sein.
Die Verbindung von IMANI COPPOLA zu Ipecac erklärt sich in erster Linie durch das musikalische Engagement Imani’s bei Pattons „Pop-Projekt“ PEEPING TOM.
Zugegeben, betrachtet unter der Selbstklassifizierung als „Pop“, macht sich bei den ersten Tönen der inzwischen schon achten Veröffentlichung der New Yorker Sängerin und Multi-Instrumentalistin zunächst so etwas wie Genugtuung breit. Denn zieht man den Großteil der uniform weichgespülten Chart-Musik als Vergleichs-Grundlage für diese Platte heran, klingt das hier zunächst doch schon alles sehr aufregend und angenehm frisch.
Die Londoner Künstlerin M.I.A. hat es vor einiger Zeit vorgemacht, wie sie aussehen kann, die Vision der Zukunft von, Verzeihung, Pop-Musik im 21. Jahrhundert, mit einer Grenzen sprengenden Fusion aus, ja was eigentlich? Vielleicht so etwas wie globalisiertem Großstadt-Sound.
Eine ähnliche Hoffnung lege ich auch in diese Platte, und zunächst scheint sie sich auch zu erfüllen: „Spring time“ ist ein stilistisch durchaus vielfältiges und funktionierendes Song-Gebilde, das vor Entschlossenheit strotzt. Auffällig die kraftvolle Produktion, die vor allen Dingen beim nachfolgenden wütenden Track „Woke up white“ ein gutes Beispiel liefert, wie dreckiger Punk-Sound auch innerhalb einer modernen Pop-Produktion funktionieren kann, ohne an Authentizität einzubüßen.
Spätestens ab der Mitte der Platte stellt sich bei mir aber Unruhe ein: Das Album droht immer wieder in musikalische Klischees abzurutschen und schrammt an dem, was ich mir erhofft hatte, oft nicht mal knapp vorbei.
Und: Das nicht mal von mir, sondern auch in der Band-Info mit z. T. fragwürdigen Formulierungen („Bi-racial beauty“) geformte Bild der multikulturell, in den Großstädten dieser Welt aufgewachsenen, exzentrischen Künstlerin, das bei M.I.A. so gut funktioniert, wirkt hier irgendwie zusehends bemüht und konstruiert. Und fängt zum Schluss der Platte sogar fast schon ein bisschen an zu nerven.