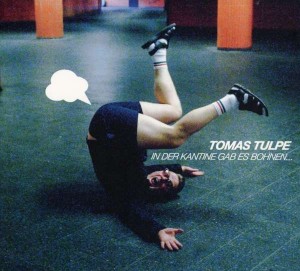NEUROSIS loten keine Extreme mehr aus. Been there, done that: 1996 kollidierte ihr Planet „Through silver in blood“ mit der Musikwelt – ihren Sound, eine Mischung aus Hardcore, Sludge/Doom Metal, Progressive und Psychedelic Rock, Ambient und Industrial, hatten sie auf diesem Album zu einer fast undurchlässigen Wand verdichtet. Die Lieder legten sich über einen wie Mäntel aus Blei und rissen einen mit in die Tiefe. Eins der drückendsten Alben, die ich je gehört habe. Das war nicht zu steigern, so dass NEUROSIS anschließend nach und nach etwas besinnlicher wurden, bis sie 2004 mit „The eye of every storm“ ihre Umsetzung der „Quiet is the new loud“-Idee präsentierten – wieder ein extremes Album, bedrohlich, furchteinflößend und auf seine Art mindestens genauso heavy wie „Through silver in blood“, aber erheblich leiser. Vermutlich bleiben diese beiden Meisterwerke die Pole, zwischen denen alles pendelt, was danach noch kommt. „Given to the rising“ von 2007 war dabei näher an den lauten NEUROSIS der Neunziger, der Schwerpunkt lag wieder auf schweren Riffs, „Honor found in decay“ bewegt sich nun ein wenig zurück in ruhigere Gefilde.
Vom ersten Stück an wird deutlich: Es geht nicht mehr vorwiegend darum, zu erschüttern, zu überwältigen oder gar zu reinigen (kaum ein NEUROSIS-Review kommt ohne den Begriff ‚Katharsis’ aus). So zugänglich und ausgewogen klangen sie noch nie, von daher eignet sich „Honor found in decay“ auch hervorragend als Einstieg in die Welt dieser Band. Längen und Prunk gehören der Vergangenheit an; auf „Honor found in decay“ ist alles an seinem Platz, die typischen Elemente des NEUROSISschen Sounds – Tribal Drumming, dunkle Riffs, akustische Gitarren, Geraune, Gestöhne, Gebrüll und sogar Gesang, Dark Ambient-Flächen und Spoken Word-Passagen – werden so gezielt eingesetzt, wie vielleicht noch nie zuvor. Weil mir gerade das Überfrachtete an ihrem Sound immer so gut gefallen hat, musste ich mich erstmal an die neue Ordnung gewöhnen. „Die werden eben auch älter und routinierter und können nicht mehr so“, dachte ich, aber das war natürlich Quatsch. Nach etlichen Durchläufen ist mir dann mal wieder klar geworden, dass es trotz des gigantischen Heers an Nachahmern (übrigens auch so ein Gedanke, der häufiger in NEUROSIS-Reviews auftaucht: Das ist nicht nur eine Band, sondern ein eigenes Genre!) niemanden gibt, der derart strenge, herbe Riffs schieben, so wunderschön leidgeplagt ächzen oder sogar einen Dudelsack (nachzuhören in „At the well“) so würdevoll einbauen kann.
Produziert wurde zum fünften Mal in Folge von Steve Albini, und auch wenn dessen sehr auf Unmittelbarkeit abzielende (auf mich manchmal fast klaustrophobisch wirkende) Aufnahmetechnik scheinbar im Widerspruch steht zur epischen Aura, die die sechs Kalifornier schon immer umweht hat: Die durch diese Produktion besonders betonten Einflüsse von Country und dunklem Folk (Scott Kelly und Steve Von Till, die Sänger und Gitarristen, hauen hin und wieder Folkalben raus und haben auch schon Lieder von Townes Van Zandt gecovert) rücken die Musik, die sich sonst eher unheilvoll über einem aufgetürmt hat, sehr nahe an einen heran, das Inferno von ehedem hat sich in ein wärmendes Herdfeuer verwandelt, ohne dabei irgendwas an Größe eingebüßt zu haben. Selbst die Texte mit den altbekannten Motiven (die Elemente und die Jahreszeiten, die Schlange, das Biest, Blut, Berge, Sonne, Mond und Sterne) wirken nicht mehr abgehoben esoterisch, sondern vertraut und beruhigend.
Gelegentlich übertreiben sie es ein bisschen oder schwelgen zur sehr in Selbstzitaten, aber selbst ein für mich schwächerer Moment wie der ausgelutschte Postrock-Mittelpart von „My heart for deliverance“ wird sofort wieder ausgeglichen durch die großartig kranken Gitarrenlinien, die am Ende des Stücks übereinander gelegt werden. Auch ein für ihre Verhältnisse eher gewöhnliches Stück wie „All is found…in time“ mündet in einen verstörenden, noisigen Schluss. Der meiner Meinung nach beste Song ist der letzte, „Raise the dawn“. Hier rocken sie (wenn auch sehr langsam und mächtig) auf eine böse, an die MELVINS erinnernde Weise, bis das Stück mit Geige und Banjo countryartig ausklingt, ohne dass das irgendwie aufgesetzt wirkt.
Auch wenn der Exzess diesmal meistens ausfällt: Mich hat das Spannungsverhältnis zwischen Gelassenheit und sich in den sieben Stücken von „Honor found in decay“ dann doch immer wieder auftuenden Schwarzen Löchern schließlich so in seinen Bann gezogen, dass ich seit langer Zeit mal wieder Lust bekommen habe, auch die älteren Sachen zu hören. Und gleichzeitig bin ich gespannt, wie es weitergeht.