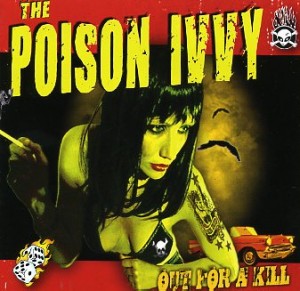Zäune sind Hürden, aber keine Hindernisse.
Mir schwebt eine Musik in Bildern vor. Eine Musik für eine Zukunft, die es schon gestern gegeben hat. Eine Platte für meinen Spieler, die ich nur immer wieder umzudrehen brauche. Vorn wie hinten klingt sie gleich. Aber das ist es, das ist sie: JOHN ROBERTS’ „Fences“. Erst sie hat mich von ihm überzeugt. Und meine Tage lichterloh bebildert.
Genre: Deep House experimental mit Getrommel, ohne auftrumpfend seelige Diskoanteile. Zehn Tracks in Zeiten von 1:17 bis 6:34 in nur 37:43 Gesamtlänge. Zwei schwarze Scheiben in 45er Geschwindigkeit. Ungewöhnlich kurz, finde ich, und sonst auch ungewöhnlich, auch wenn ich nur eine gute Handvoll Scheiben solcher Art in meinem Aufbewahrungsschuber habe. Ungewöhnlich für was und wen?
Diesem werde ich mich peu à peu annähern: Nehme ich ROBERTS’ vorheriges Album hinzu, tun sich mir viele Parallelen auf, bieten sich förmlich an: in Struktur und Klangmuster. Etwas mehr Klavierakkorde und Knistern – melancholisch nachdenklicher – auf dem alten, etwas mehr gedämpfte Perkussionselemente und Konzept – geistig präsenter – auf dem neuen Werk. Früher eher Retrospektivistisches in einer Art Zurückhaltung, jetzt das Zeugs zu etwas Konkretem: Der US-amerikanische Einzelkünstler von dem Hamburger Hauslabel Dial legt nach zahlreichen Bearbeitungen von anderen Tracks der Künstler wie PAWEL, ELLEN ALIEN, PANTHA DU PRINCE eine neue Platte auf, die das Interesse nach asiatischen Klängen erhören lässt. Sie ertönen aus Saitigem und Violinigem, das sich in „Calico“ in der Mitte des Albums einer mir fernen Tonleiter bedient und sich aktiv und attraktiv stimmungstragend neben das Andere aus Trommeln und laufender Kick legt. Hiermit belege ich das Konkrete und Ungewöhnliche zugleich, da diese Tonleiter für das Gesamte in ihrer Prägnanz erhallen und erhalten bleiben. Starke Farben, saftige Bambuswälder und Winde über zutrauliche Steppen, in denen sich ein sommerlicher Rest jedes Jahr vor dem Schnee aufzulehnen versucht.
Und letztendlich höre ich: Nichts wirkt auf mich pompös oder aufdringlich, dezent verhalten meistert Roberts sein Sammelsurium aus immer wieder rollenden und auslaufenden Beatfragmenten, die gemach an Hindernissen aus Langeweile oder Nonsens vorüber traben. Er balanciert „Fences“ gekonnt im weißen Klappcover vom Start bis ins Ziel, ohne sich oder sein Schaffen für zu wichtig zu nehmen, so scheint es. Nichts von allem kann ich mit der Graduierung „zu” besetzen, womit Roberts den Akt des schmalen Grats passiert, ohne eine Hürde zu reißen.
Die Gewohnheit, dass mein Plattenspieler also tagelang nur noch diese eine dreht, ohne dass es mir auffällt, dass das Album aus zwei Scheiben besteht, tut meiner Hörfreude nichts ab. Im Gegenteil: Ungewohnt, dass ich endlich wieder so eine Welt als Scheibe durchlaufen kann.